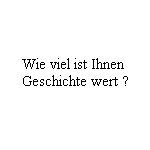Version LX
PERSONEN
Kaiser

![]() EINLEITUNG
EINLEITUNG
![]() HERKUNFT
HERKUNFT
![]() KARRIERE
KARRIERE
![]() HERRSCHAFT I
HERRSCHAFT I
![]() HERRSCHAFT II
HERRSCHAFT II
![]() TOD
TOD
![]() BEWERTUNG
BEWERTUNG
![]() ZITATE
ZITATE
Flavius Claudius Iulianus (Apostata)
Herrschaft II
Iulianus
war sehr daran gelegen, dass die alte Religion kein schwerverdaulicher
Brocken für gerade erst Christianisierten wurde. Er erarbeitete
Kultnormen aus und sorgte sich um die richtige Präsentations- und
Organisationsform. In diesem Punkt knüpfte er an eine Idee des
Maximinus Daia an und ernannte für die einzelnen Provinzen
Oberpriester, die über die Priester und Kollegien zu wachen hatten.
Als eine Art moralische Rechnungskontrolle überprüften sie die
Amtsgeschäfte ihrer Untergebenen.
Der
Kaiser war sich bewusst, dass vor allem die Menschen in den ärmeren
Bevölkerungsschichten dem Christentum besonders zugeneigt waren. Der
Grund lag darin, dass sich die sozialen Strukturen seit der Zeit der
Soldatenkaiser verändert hatten. Die Kommunen waren finanziell überlastet,
die Kluft zwischen Arm und Reich hatte sich vergrössert und niemand
wollte sich so recht um die Armen kümmern (Ist das nicht heute auch
so?). Aus diesem Grund forderte er eine Nachahmung der Solidarität,
die die christlichen Gemeinden ihren Mitgliedern gaben. Auch ihre
Einrichtungen, wie etwa Bürgerspitäler, wären in neuem Gewand zu
kopieren und über das ganze Reich zu verbreiten.
Es
versteht sich von selbst, dass eine derart plötzliche Trendwende von
vielen Menschen nicht gutgeheissen wird. Das von einem hohen
Prozentsatz Germanen durchsetzte Heer stand loyal zum Kaiser.
Problematisch waren die grossen Städte im Osten des Reiches, die in
ihrer Mehrheit schon lange Zeit dem Christentum anhingen. Die Bevölkerung
hatte sich auf die neuen Organisationsformen in den Städten
eingespielt und der erneute Systemwechsel führte zu Unstimmigkeiten.
Immerhin ging es auch um grosse Vermögenswerte, die wiederum den
Besitzer wechselten.
Auch
zeigte sich, dass die konstantinische Politik bei vielen Gläubigen
das Wissen um die Praktizierung der alten Kulte ausgelöscht hatte.
Die Götter waren zwar noch allerorts präsent, doch die
erforderlichen Formen der Religionsausübung hatten während der
letzten Generation in ihrer Weitergabe gelitten. Deshalb war der
Enthusiasmus, den der Kaiser so offen zur Schau stellte, auch
zahlreichen Anhängern der klassischen Religion suspekt.
Diese
Ressentiments hinderten Iulianus nicht, seine Politik zu ändern.
Vielmehr beklagte er den schleppenden Fortgang seiner Aktionen. Diese
Reaktion war mehr als unangebracht, denn das Tempo, mit der plötzlich
die Heiligtümer restauriert und Kulthandlungen vollzogen wurden,
konnte ihresgleichen suchen. Das Christentum hatte sich bei weitem
nicht in dieser Geschwindigkeit ausgebreitet. Die heidnische Reaktion
war von ihrer Sogwirkung her wesentlich erfolgreicher als die
Christianisierung zuvor.
Grosse
Sorgen bereiteten dem Kaiser die Bürger seiner Residenzstadt
Antiochia. In den neun Monaten, die er dort verbrachte stiess sein
Eifer auf breiten Widerstand. Dabei ging es nicht nur um Religion
allein. In seinem asketischen Weltbild war Iulianus auch gegen
Theater- und Circusveranstaltungen sowie einheimische Feste; wie das
Maiuma-Fest, das im Jahr 362 ausfallen musste. Erschwerend kam eine
Nahrungsmittelknappheit hinzu, die der Kaiser mittels Importen und
Preisverordnung in den Griff bekommen wollte - vergeblich.
Schliesslich brannte auch noch der lokale Daphne-Tempel ab und der
Stadtrat weigerte sich bei allen Hilfeleistungen aktiv mitzuwirken.
So
blieb es nicht aus, dass sich Iulianus am Neujahrsfest 363 zahlreiche
Spottverse anhören musste. Als Antwort verfasste er eine ironische
Beschimpfung der eigenen Person und beklagte sich öffentlich über
Unverständnis und Undankbarkeit der Menschen. Unter diesen Umständen
suchte der Kaiser nach anderen Wegen, sich beim Volk beliebt zu
machen.
Am
5. März 363 brach Iulianus zu einer der grössten Operationen zu
Felde auf. Seit mehr als fünfzig Jahren hatte kein Kaiser mehr den
Versuch gewagt, die persische Hauptstadt zu erobern. Der Plan war äusserst
riskant und wurde schon von zeitgenössischen Schriftstellern
getadelt. Zudem hatte sich der Perserkönig Schapur II. dazu bereit
erklärt, in Verhandlungen einzutreten. Folglich wäre ein Krieg in
dieser Situation nicht nötig gewesen.
Bei
den kommenden Operationen dachte Iulianus an die Erfolge in Gallien
und Germanien. In der selben Weise sollten die römischen Truppen im
feindlichen Gebiet ihre Überlegenheit und Stärke demonstrieren. Der
Kaiser selbst wollte entlang des Euphrat vorrücken, während ein
zweites Heer dem Feind über Armenien in den Rücken fallen sollte.
Diese Zangenoperation - für die römische Kriegsführung eigentlich
nichts besonderes - ging gründlich in die Hose. Schon die Planungen
waren von Pannen überschattet und im Endeffekt fiel die zweite Armee
aus. Auf der Hauptroute mussten sich Iulianus’ 46.000 Mann zählende
Truppen zudem mit dem hochwasserführenden Euphrat herumschlagen.
Ktesiphon konnte nach einem Anfangserfolg zwar bereits im Juni 363
erreicht und belagert werden, doch für eine längerfristige Operation
waren in den Planungen keine Ressourcen vorgesehen gewesen. So musste
die Belagerung aufgegeben werden.

Statue des Iulianus
Sie wollen Fragen stellen, Anregungen
liefern oder sich beschweren?
Dann klicken Sie auf meine Kontaktseite!
(PL)